#6 - Mai 2025
Themen in dieser Ausgabe:
- Neuigkeiten
- Entropie
- Bedeutende Frauen der Informatik: Katherine Johnson
- Links und Leseempfehlungen
- Neulich im Podcast & im Internet
- Last, but not least
Hallo ,
der Monat Mai liegt hinter uns und wieder einmal ist viel passiert. Für mich gab es im vergangenen Monat einige Premieren, die wirklich sehr schön waren.
Den Anfang machte die Stay Forever Convention in Karlsruhe. Im letzten Jahr konnte ich zeitlich leider nicht teilnehmen, umso mehr freute ich mich, dass es in diesem Jahr geklappt hat. Das waren zwei Tage voll mit netten Leuten, einem hohen Nerdfaktor und tollem Content rund um das Thema Retrogaming und Popkultur.
 Und ich habe dort endlich den wunderbaren Daniel vom Heldendumm Podcast getroffen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, bisher hatten wir aber immer nur digital miteinander zu tun. Ich denke vor allem gerne an unsere gemeinsame Podcastfolge #52 zu Jan Sloot zurück. Wir haben die Zeit nicht nur zum lockeren Plaudern genutzt, sondern auch Pläne für kurz- und langfristige gemeinsame Projekte geschmiedet. Mehr kann ich noch nicht verraten, aber soviel sei gesagt: Ich freue mich darauf.
Und ich habe dort endlich den wunderbaren Daniel vom Heldendumm Podcast getroffen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, bisher hatten wir aber immer nur digital miteinander zu tun. Ich denke vor allem gerne an unsere gemeinsame Podcastfolge #52 zu Jan Sloot zurück. Wir haben die Zeit nicht nur zum lockeren Plaudern genutzt, sondern auch Pläne für kurz- und langfristige gemeinsame Projekte geschmiedet. Mehr kann ich noch nicht verraten, aber soviel sei gesagt: Ich freue mich darauf.
Und dann traf ich auf der Veranstaltung auch noch Christian vom Thinkpad Museum Podcast. Wir kannten uns auch schon aus dem Netz und es war schön, Christian endlich mal in echt zu treffen. Und auch hier wurden direkt Pläne für ein gemeinsames Projekt gemacht.
Ansonsten war ich noch wie in der letzten Ausgabe angekündigt in Thüringen, um dort beim Rennsteiglauf an den Start zu gehen. Das war für mich eine wirklich schöne Erfahrunge, denn bisher war ich noch nie so weit am Stück gelaufen. Einen kleinen Bericht darüber findet ihr in meinem Sportblog. Der Lauf hat mir auch nochmal viel Selbstvertrauen für mein sportliches Jahreshighlight im Juni gegeben. Da werde ich nämlich in Garmisch-Partenkirchen beim Zugspitz Ultralauf antreten und einmal um die Zugspitze herumlaufen. Das wird vermutlich ein sehr langer Tag werden.
Und sonst gab es natürlich noch viele spannende Podcastfolgen, tolle Diskussionen in Discord und beinahe täglich interessante News aus der Technikwelt. Ich staune derzeit wirklich sehr oft über die neuen Entwicklungen, die gerade in den Bereichen Robotik und KI gemacht werden. Und ich frage mich auch, wieviele Menschen von dieser Geschwindigkeit eigentlich abgehängt werden. Wie geht es dir dabei? Hast du das Gefühl, dass du alles verstehst? Oder fühlst du dich manchmal auch ein bisschen verloren? Antworte mir doch gerne auf diese Mail oder schreibe mir in Discord.
In dieser Ausgabe der Anomalie findest du einen Artikel über den Begriff der Entropie. Oftmals wird dieser mit einem Maß für Unordnung umschrieben. Und zum Teil stimmt das auch. Aber es steckt noch mehr dahinter. Außerdem habe ich dir wieder ein Portrait von einer Frau mitgebracht, die großartige Leistungen im Bereich der Informatik und vor allem Mathematik vollbracht hat: Katherine Johnson.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und einen tollen Juni!
Wenn du Feedback für mich hast, kannst du mir gerne direkt auf diese Mail antworten.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Entropie - Von der Wissenschaft der Unordnung
Wenn man sich mit Informatik beschäftigt, stößt man früher oder später auf den Begriff Entropie. Und der ist oft nicht ganz leicht zu fassen. In Ausgabe #3 habe ich ihn im Zusammenhang mit der Erzeugung von Zufallszahlen erwähnt und damals geschrieben, dass Entropie die Unordnung in Systemen beschreibt. Das ist zwar nicht falsch – aber der Begriff ist komplex und spannend genug, um ihm einmal etwas ausführlicher auf den Grund zu gehen. Und du ahnst es vermutlich schon: Das hier ist wieder erstklassiges Partywissen!
Ordnung, Chaos und Entropie
Starten wir mit einem anschaulichen Beispiel: Stell dir eine Wohnung vor, in der alle Gegenstände ihren festen Platz haben. Die Bücher stehen in alphabetischer Reihenfolge im Regal, die Gläser sind im Schrank akkurat sortiert, und die Kissen liegen millimetergenau auf der Couch. Ich kenne Leute, bei denen ich wirklich den Eindruck habe, dass sie ihre Wohnung exakt so organisieren. Ich selbst zähle da eher nicht dazu.
In dieser idealisierten Wohnung gäbe es exakt eine Art und Weise, wie sie „perfekt aufgeräumt“ sein kann. Doch sobald du etwas Leben hineinbringst – etwa deinen Alltag, Besuch oder Kinder –, wird sie Stück für Stück unordentlicher. Kissen werden verrückt, eine Socke landet hinter der Couch, der Inhalt deiner Hosentaschen verteilt sich auf der Kommode.
Und hier wird es interessant: Während es eine perfekte Ordnung gibt, existieren unendlich viele Möglichkeiten, wie Unordnung aussehen kann. Genau hier kommt Entropie ins Spiel. Sie lässt sich als Maß für Unordnung verstehen. Das aufgeräumte Zimmer hat eine niedrige Entropie, das chaotische eine hohe.
Ein weiteres Beispiel: Eine Tasse fällt zu Boden und zerspringt in viele Scherben. Während es nur eine Möglichkeit gibt, wie die Tasse ganz ist, gibt es unzählige Arten, wie sie kaputt sein kann.
Von der Thermodynamik zur Informationstheorie
Entropie beschreibt also, wie „ungeordnet“, „zufällig“ oder „unvorhersehbar“ ein System ist. Je mehr Möglichkeiten es gibt, etwas unterschiedlich zu arrangieren, desto höher ist die Entropie. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Physik, genauer gesagt aus der Thermodynamik. Dort bezeichnet er die Unordnung in einem abgeschlossenen System – und damit auch die Richtung, in die sich Prozesse entwickeln: nämlich von Ordnung zu Unordnung.
In den 1940er Jahren übertrug der US-Ingenieur Claude Shannon das Konzept auf die Informationstheorie. In diesem Kontext beschreibt Entropie die durchschnittliche Informationsmenge pro Zeichen – oder einfacher: Wie überraschend ist die nächste Information?
Ein Beispiel:
Ein Text, der nur aus dem Buchstaben „A“ besteht, hat eine Entropie nahe null. Ein Text mit zufällig gewählten Buchstaben aus dem Alphabet hat dagegen eine hohe Entropie.
Aber: Sobald diese Buchstaben Muster bilden – etwa Wörter oder Sätze –, sinkt die Entropie. Denn Struktur bedeutet Vorhersehbarkeit. Grammatik und Syntax sorgen dafür, dass ein Text geordnet wird.
Für unser menschliches Verständnis wirkt das kontraintuitiv. Ein geordneter Text mit Sinn und Inhalt erscheint uns wertvoll – und damit informationsreich. Doch technisch betrachtet ist es genau andersherum:
Ein Text, dessen nächstes Zeichen nicht vorhersagbar ist, trägt mehr technische Information – also höhere Entropie. Wir müssen hier unterscheiden zwischen technischem und semantischem Informationsgehalt. Der eine ist für Maschinen relevant, der andere für uns Menschen.
Warum Entropie im digitalen Alltag wichtig ist
Entropie spielt eine zentrale Rolle bei der Datenkompression. Ob MP3, ZIP oder JPG – Kompression funktioniert umso besser, je geringer die Entropie ist. Ein Text mit 1000 mal dem Buchstaben „A“ lässt sich hervorragend komprimieren („1000xA“). Bei einem Text mit 1000 zufälligen Zeichen ohne Muster funktioniert das nicht – hier steckt in jedem Zeichen neue, nicht vorhersehbare Information.
Auch in der Kryptografie ist Entropie entscheidend. Moderne Verschlüsselung basiert auf Zufallszahlen. Doch echte Zufallszahlen zu erzeugen, ist für Computer gar nicht so einfach – wie ich in Ausgabe XXX schon ausführlich erklärt habe. Und doch ist genau dieser Zufall nötig, damit sich kryptografische Schlüssel nicht erraten lassen.
Ein klassisches Beispiel: das Passwort. Wir nutzen sie täglich – und hoffentlich nicht dasselbe für alles. Ein gutes Passwort ist nicht nur lang, sondern auch möglichst unvorhersehbar. Also: hohe Entropie.
Fazit: Zufall ist eine Stärke
Wenn man das alles bedenkt, wird klar: Entropie ist mehr als bloße Unordnung. Sie steht nicht für Chaos im negativen Sinne, sondern für Vielfalt, Zufälligkeit und Sicherheit. In unserer digital bestimmten, oft deterministischen Welt ist der Zufall ein wertvolles Gut. Er sorgt für Robustheit, schützt unsere Daten – und bringt genau das Quäntchen Unvorhersehbarkeit mit, das unsere Systeme sicherer und unsere Welt interessanter macht.
Quellen
- https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie
- https://de.wikipedia.org/wiki/Entropie_(Informationstheorie)
- Prof. Dr. Haye Hinrichsen: Entropie als Informationsmaß (PDF)
- https://jasonfantl.com/posts/What-is-Entropy/
Bedeutende Frauen der Informatik: Katherine Johnson
In dieser Ausgabe erzähle ich dir die Geschichte einer Frau, die als Kind gerne alles Mögliche zählte – und in ihrem späteren Leben selbst zu einem Computer wurde. Katherine Johnson war eine Frau mit einem außergewöhnlichen Talent für Mathematik – und das zeigte sich schon sehr früh.
Sie wurde am 26. August 1918 in White Sulphur Springs, West Virginia, geboren – in einer Zeit, in der Bildung für schwarze Frauen keine Selbstverständlichkeit war. Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater Farmer, der zeitweise auch als Hausmeister arbeitete.
 Die junge Katherine zeigte schon als Kind eine große Begeisterung und Begabung für Mathematik. Nach eigenen Angaben zählte sie ständig Dinge – die Teller beim Abwasch ebenso wie die Schritte von zu Hause zur Schule. Und das war nicht das Einzige, das sie interessierte. Noch bevor sie eingeschult wurde, hatte sie lesen gelernt – und wurde dann im Alter von sechs Jahren direkt in die zweite Klasse geschickt. Sie war eine hervorragende Schülerin und übersprang im fünften Schuljahr erneut eine Klasse. Während ihrer Schulzeit entwickelte sich auch ihr Interesse für Astronomie.
Die junge Katherine zeigte schon als Kind eine große Begeisterung und Begabung für Mathematik. Nach eigenen Angaben zählte sie ständig Dinge – die Teller beim Abwasch ebenso wie die Schritte von zu Hause zur Schule. Und das war nicht das Einzige, das sie interessierte. Noch bevor sie eingeschult wurde, hatte sie lesen gelernt – und wurde dann im Alter von sechs Jahren direkt in die zweite Klasse geschickt. Sie war eine hervorragende Schülerin und übersprang im fünften Schuljahr erneut eine Klasse. Während ihrer Schulzeit entwickelte sich auch ihr Interesse für Astronomie.
Ihre Begabung – insbesondere für Mathematik – sorgte dafür, dass sie die Schule schnell hinter sich lassen konnte. Sie bekam ein Stipendium und begann mit gerade einmal 14 Jahren ein Studium am College. Dort studierte sie Mathematik und Französisch und erhielt mit 18 Jahren ihren Bachelor mit Auszeichnung. Das war 1937.
Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Lehrerin. Ihr Leben sollte sich jedoch ändern, als sie in den frühen 1950er-Jahren davon hörte, dass es beim National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), dem Vorläufer der NASA, Karrieremöglichkeiten für schwarze Mathematikerinnen gab. Man muss sich das heute noch einmal bewusst machen: Zu dieser Zeit war es alles andere als selbstverständlich, dass eine schwarze Frau in den USA eine Karriere machte – und schon gar nicht unter gleichen Bedingungen wie ein weißer Mann.
Katherine Johnson bekam den Job und begann ihre Arbeit in der Abteilung „West Area Computers“. Dort führte sie zusammen mit anderen afroamerikanischen Frauen Berechnungen durch – von Hand. Damals war „Computer“ die gängige Bezeichnung für Menschen – meist Frauen – die manuell komplexe Rechenaufgaben erledigten.
Die Frauen arbeiteten aufgrund der Rassentrennung in getrennten Büros und konnten bei Bedarf von anderen Abteilungen angefordert werden. Für Katherine Johnson bedeutete das, dass sie nach zwei Wochen in einer Forschungsabteilung landete, die sich mit der Berechnung von Flugbahnen beschäftigte. Eigentlich sollte sie dort nur vorübergehend tätig sein. Doch sie brachte zwei entscheidende Dinge mit: zum einen ein tiefes Verständnis für Mathematik und Geometrie, zum anderen eine große Neugier. Sie begnügte sich nicht damit, lediglich ihr zugewiesene Berechnungen durchzuführen – sie stellte Fragen, wollte an Briefings teilnehmen und das große Ganze verstehen.
 Aus der kurzfristigen Unterstützung wurde ein fester Job in dieser Abteilung. Sie war bis dahin die einzige Frau, der dieser Schritt gelang – und sie wurde schnell unentbehrlich.
Aus der kurzfristigen Unterstützung wurde ein fester Job in dieser Abteilung. Sie war bis dahin die einzige Frau, der dieser Schritt gelang – und sie wurde schnell unentbehrlich.
In den folgenden Jahren schuf sie die theoretischen Grundlagen für die Raumfahrt der NASA. Weil es damals noch keine Literatur zu diesen Themen gab, verfasste sie selbst mehrere Fachpublikationen. Sie war am gesamten bemannten Raumfahrtprogramm beteiligt und half unter anderem beim Unglück von Apollo 13, indem sie die Flugbahn für die Rettung der Kapsel berechnete. Im Film dazu taucht sie leider nicht auf – allerdings wird sie im sehr empfehlenswerten Film Hidden Figures gewürdigt.
Katherine Johnson war bis 1986 bei der NASA tätig. Nach ihrer Pensionierung engagierte sie sich mit Vorträgen an Schulen und Universitäten, um junge Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern.
Erst spät erhielt sie die verdiente Anerkennung: 2015 wurde ihr von Barack Obama die Presidential Medal of Freedom verliehen – eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA.
Katherine Johnson starb im Februar 2020 im Alter von 101 Jahren. Ihr Erbe lebt weiter – in den Berechnungen, die Menschen zum Mond brachten, in der Inspiration, die sie nachfolgenden Generationen schenkt, und in der Erkenntnis, dass Exzellenz keine Frage von Herkunft oder Geschlecht ist.
Ich mag dieses Zitat von ihr besonders:
"Girls are capable of doing everything men are capable of doing. Sometimes they have more imagination than men."
Quellen
- Foto 1: Katherine Johnson bei ihrer Arbeit bei der NASA 1966, Wikimedia Commons
- Foto 2: Katherine Johnson mit der Presidential Medal of Freedom (2015), Wikimedia Commons
- https://www.mothersinscience.com/trailblazers/katherine-johnson
- https://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Johnson
- https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/katherine-johnson-the-girl-who-loved-to-count/
- https://www.nasa.gov/learning-resources/katherine-johnson-a-lifetime-of-stem/
- https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/she-was-a-computer-when-computers-wore-skirts/
Links und Leseempfehlungen
Fehler können auch schön sein Die Glitch Gallery zeigt kunstvolle Fehlermeldungen und Darstellungsfehler.
Dieses Video wurde komplett mit KI erstellt Die neue Video KI VEO 3 von Google ist beeindruckend - und auch ein bisschen gruselig. Ich bin ehrlich: Der Clip sieht für mich nicht künstlich aus.
Internet Artifacts Eine Sammlung von ikonischen digitalen Artefakten aus der Geschichte des Internetes. Die Seite läd dazu ein, je nach Alter in Erinnerungen zu schwelgen, bzw. sich darüber zu wundern, wie das mit dem Internet alles mal angefangen hat.
Wieviel Energie braucht eigentlich KI? Dieser lange Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wieviel Energie uns die KI-Revolution eigentlich kostet.
Neulich im Podcast & im Internet
Digitale Anomalien #104: Ghost Trains & Lost Trains
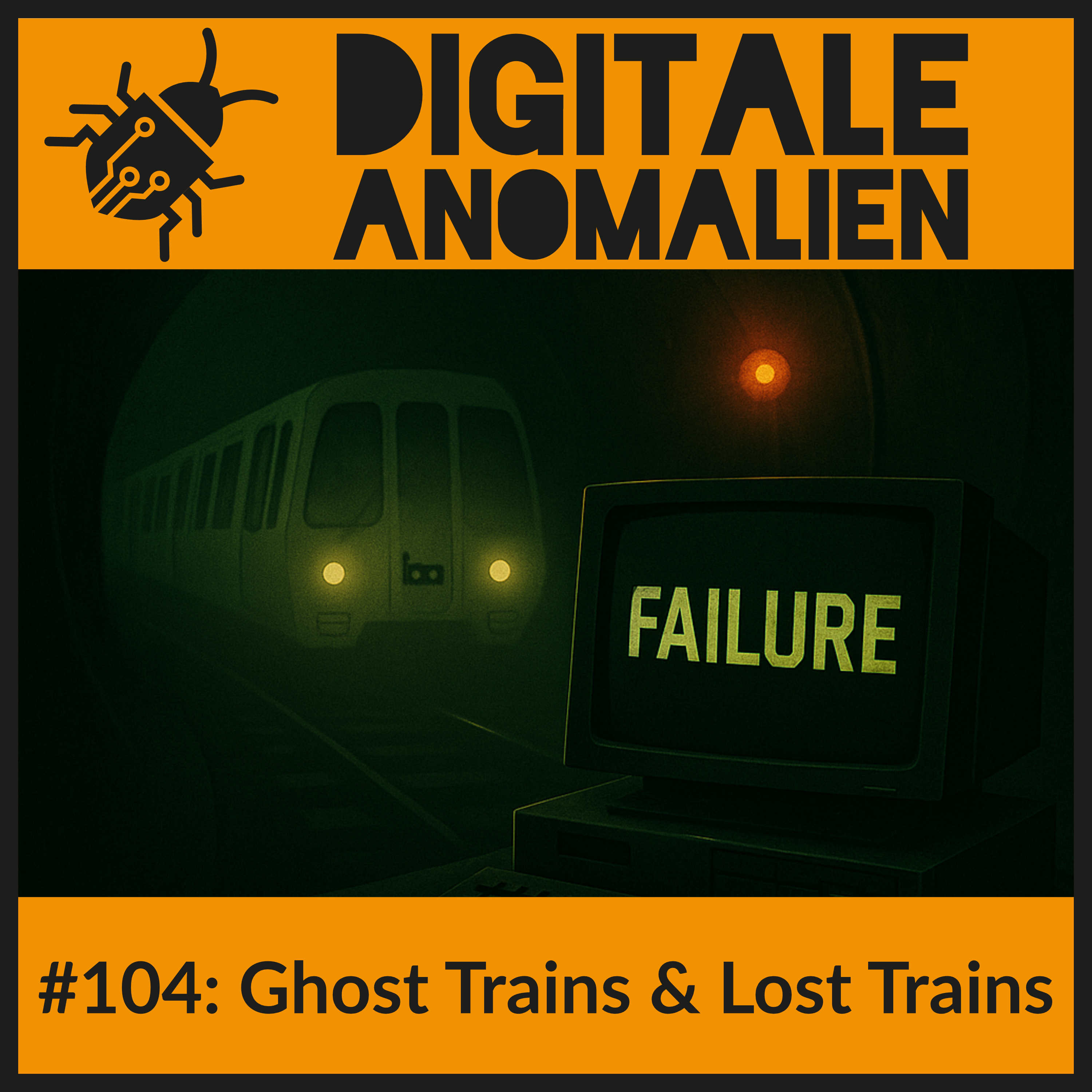 BART (Bay Area Rapid Transit) sollte damals San Francisco und die umliegenden Städte vor dem Verkehrskollaps retten und ein zuverlässiges, schnelles und preiswertes Verkehrsmittel schaffen. Das Projekt war und ist hochkomplex und so gab es im Laufe der Zeit viele Komplikationen und Probleme.
BART (Bay Area Rapid Transit) sollte damals San Francisco und die umliegenden Städte vor dem Verkehrskollaps retten und ein zuverlässiges, schnelles und preiswertes Verkehrsmittel schaffen. Das Projekt war und ist hochkomplex und so gab es im Laufe der Zeit viele Komplikationen und Probleme.
Diese Episode des Podcasts geht hinter die Kulissen von BART und erzählt die Geschichten einiger der bemerkenswertesten technischen Probleme. Warum schoss ein Zug weit über sein Ziel hinaus? Was hat es mit Geisterzügen und verlorenen Zügen auf sich? Und warum waren Windows 98 und DOS noch vor wenigen Jahren im produktiven Einsatz?
Es wird gruselig! Allerdings nicht wegen Geistern, sondern wegen der harten Realität.
Digitale Anomalien #105: Kuriose Geschichten vom Marathon (Analoge Anomalien #6)
 In den Analogen Anomalien werden kuriose Geschichten jenseits von Computern erzählt. In dieser Folge dreht sich alles um den Laufsport. Genauer gesagt um den Marathon. Bereits dessen Entstehungsgeschichte ist kurios und basiert auf einer alten Legende und der modernen Wiederbelebung der Olympischen Spiele.
In den Analogen Anomalien werden kuriose Geschichten jenseits von Computern erzählt. In dieser Folge dreht sich alles um den Laufsport. Genauer gesagt um den Marathon. Bereits dessen Entstehungsgeschichte ist kurios und basiert auf einer alten Legende und der modernen Wiederbelebung der Olympischen Spiele.
Diese Folge erzählt, warum man früher auch mal Gift während des Marathon eingenommen hat, wieso vor einigen Jahren tausende Menschen den Magen mit Seife verdorben und warum man Frauen früher die Teilnahme an solchen langen Laufveranstaltungen verboten hatte. Und noch ein bisschen mehr.
Digitale Anomalien #106: Gestrandet im All
 Die Mission Kosmos 482 war eigentlich als Venus Mission Venera 9 geplant gewesen. Durch einen Fehler beim Start konnte die Sonde allerdings nicht die Erdumlaufbahn verlassen. Und so verblieb sie dort für über 50 Jahre.
Die Mission Kosmos 482 war eigentlich als Venus Mission Venera 9 geplant gewesen. Durch einen Fehler beim Start konnte die Sonde allerdings nicht die Erdumlaufbahn verlassen. Und so verblieb sie dort für über 50 Jahre.
Im Laufe dieser Zeit näherte sie sich immer weiter der Erde an, sodass auch der Zeitpunkt des Einschlags immer präziser bestimmt werden konnte. Allerdings nicht völlig exakt. Und da der Lander der Sonde den sehr harten Umweltbedingungen der Venus trotzen sollte, war man sicher, dass dieser nicht völlig in der Erdatmosphäre verglühen würde. Am Ende ging aber alles gut, und der Weltraumschrott stürzte ins Meer.
Diese Folge erzählt die Geschichte von dieser Mission, die lange im All unterwegs war, um dann am Ende wieder auf die Erde zu stürzen.
Grobe Pixel #43: Edna bricht aus
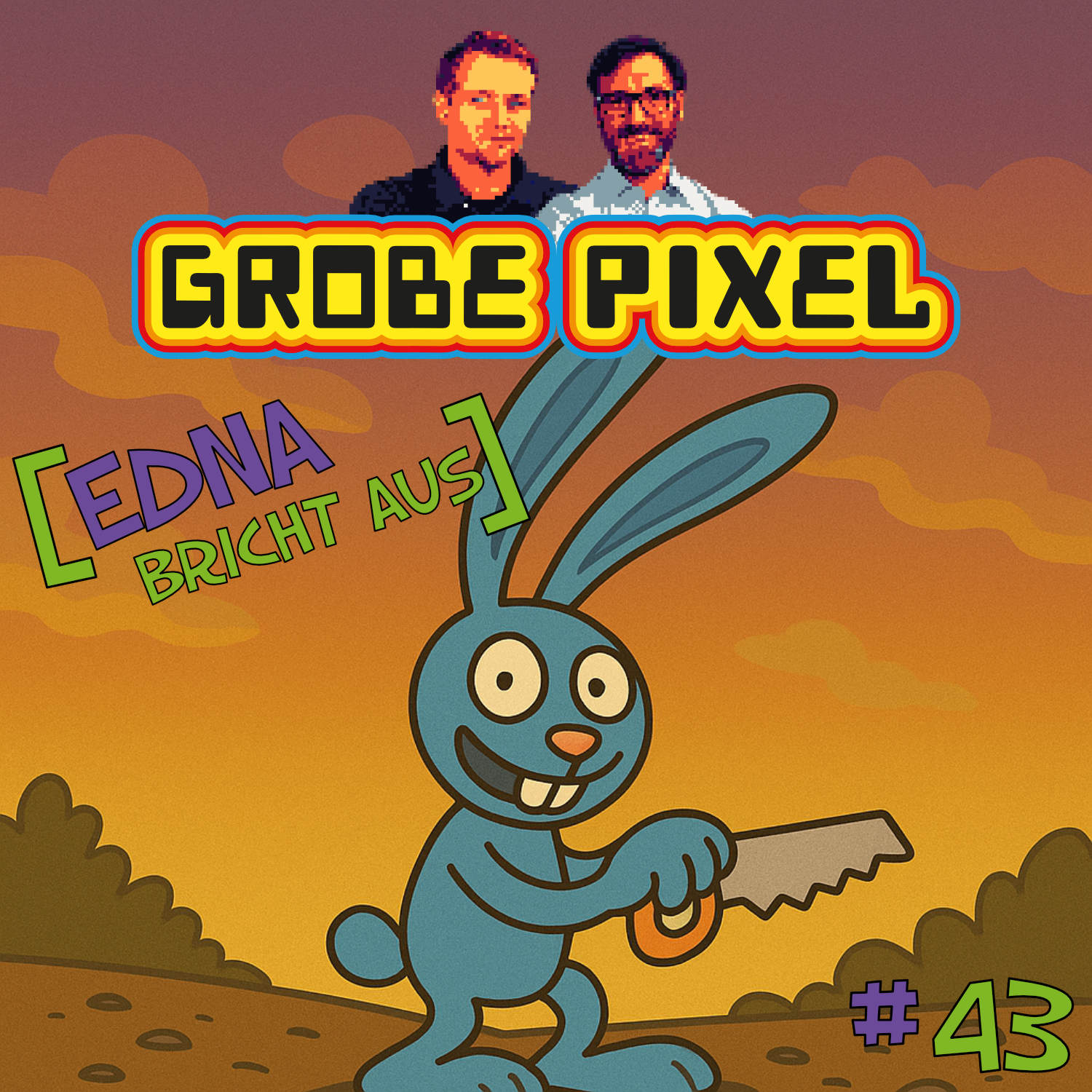 Das Spiel Edna bricht aus entstand aus der Diplomarbeit von Jan Baumann alias Poki. Außerdem handelt es sich um das Erstlingswert von Daedalic Entertainment. Im Spiel ergründen wir, warum Edna in einer Psychiatrie ist und dort einer Charakterkorrektur unterzogen werden soll. Das Setting ist humorvoll, bringt aber auch ernste Themen mit und ist eher an ein älteres Publikum gerichtet. Als das Spiel im Jahr 2008 erschien, wurde es zu einem großen Erfolg und heute gilt es als Kultspiel.
Das Spiel Edna bricht aus entstand aus der Diplomarbeit von Jan Baumann alias Poki. Außerdem handelt es sich um das Erstlingswert von Daedalic Entertainment. Im Spiel ergründen wir, warum Edna in einer Psychiatrie ist und dort einer Charakterkorrektur unterzogen werden soll. Das Setting ist humorvoll, bringt aber auch ernste Themen mit und ist eher an ein älteres Publikum gerichtet. Als das Spiel im Jahr 2008 erschien, wurde es zu einem großen Erfolg und heute gilt es als Kultspiel.
Christian und ich sprechen ausführlich über die Entwicklungsgeschichte des Spiels und den Eindruck, den es bei uns hinterlassen hat.
Zeitflimmern #8: Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine!
 Diesmal besprechen wir Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine! aus dem Jahr 2010.
Diesmal besprechen wir Hot Tub – Der Whirlpool … ist ’ne verdammte Zeitmaschine! aus dem Jahr 2010.
Hot Tub Time Maschine ist der nächste Film den wir uns angesehen haben.
Ein Typ verliert fast seinen Arm und auf der Skipiste ist die Hölle los. Also trinken unsere Zeitreisenden erstmal einen Kakao.
In der achten Episode geht es um Hot Tub Time Machine! Einige Freunde werden per Zeitreise in ihre jugendlichen Ichs transportiert. Doch wer ist eigentlich der große weiße Büffel und warum sollte man immer ein wenig Chernobly dabei haben? Findet es mit uns zusammen heraus.
Digital Future #82: Von der Revolution zur Reife: Kubernetes heute
 Kubernetes – früher ein Technologietrend moderner Infrastruktur, heute ein fester Bestandteil vieler IT-Landschaften. In dieser Episode werfen wir einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte von Kubernetes, beleuchten, wo die Plattform heute steht – und wo sie vielleicht überdimensioniert ist.
Kubernetes – früher ein Technologietrend moderner Infrastruktur, heute ein fester Bestandteil vieler IT-Landschaften. In dieser Episode werfen wir einen Blick zurück auf die Entstehungsgeschichte von Kubernetes, beleuchten, wo die Plattform heute steht – und wo sie vielleicht überdimensioniert ist.
Wir sprechen mit K8-Experte Maximilian Bischoff darüber, wann Kubernetes die richtige Wahl ist – und wann andere Lösungen den besseren Weg darstellen. Außerdem gibt Maximilian Einblicke in den Alltag eines Kubernetes Engineers und klärt u. a. die Fragen: Wie viel Automatisierung ist inzwischen Realität? Und was bringt die Integration mit Künstlicher Intelligenz?
Zum Abschluss wagen wir einen Ausblick: Kubernetes gilt als stabil – aber wie wird es sich weiterentwickeln?
Last, but not least
Die Kaffeekasse Die Anomalie und der Podcast sind kostenlos und entstehen in meiner Freizeit. Hauptsächlich, weil mir das viel Spaß macht. Ich habe aber eine kleine virtuelle Kaffeekasse auf der Plattform Ko-Fi und freue mich da über den ein oder anderen virtuellen Kaffee, den ich selbstverständlich zeitnah in ein koffeinhaltiges Heißgetränk umwandeln werde. https://ko-fi.com/herrschoch
Twitch Einmal in der Woche bin ich live auf Twitch und rede da über die aktuellen Techniknews der Woche. In der Regel ist das am Mittwoch gegen 18 Uhr. https://www.twitch.tv/herrschoch
Themenvorschläge Welches Thema würde dich denn in einer der nächsten Ausgaben interessieren? Schreibs mir gerne als Antwort auf diese Email.
PS: Füge meinen Absender hallo@digitaleanomalien.de deinen Kontakten hinzu, damit der Newsletter auch zuverlässig bei dir ankommt und nicht im Spam landet.
