#7 - Juli 2025
Themen in dieser Ausgabe:
- Neuigkeiten
- Kompression
- Bedeutende Frauen der Informatik: Brenda Laurel
- Links und Leseempfehlungen
- Neulich im Podcast & im Internet
- Last, but not least
Hallo ,
die kleine Sommerpause ist vorbei und damit geht es hier im Magazin und auch im Podcast wieder weiter. In dieser Ausgabe findest du einen kompakten Artikel über Datenkompression - eine perfekte Ergänzung zum Thema von Podcast Folge #108. Und das ist kein Zufall. Als ich nämlich die Folge vorbereitet hatte, merkte ich, dass das Thema so spannend ist, dass sich daraus ein eigener Beitrag machen ließe. Und das habe ich dann auch gemacht. Das Ergebnis kannst du in dieser Ausgabe nachlesen.
Außerdem habe ich noch ein kleines Porträt zu Brenda Laurel geschrieben. Sie hat sich in ihrer Arbeit unter anderem die Frage gestellt, warum Mädchen so wenig Interesse an Videospielen haben. Und sie hat eine faszinierende Antwort darauf gefunden.
Wie war dein Sommer bisher? Wie in der letzten Ausgabe bereits angekündigt, war ich in Garmisch-Partenkirchen und bin dort beim Zugspitz Ultralauf über gut 100 km mitgelaufen. Das war eine sehr spannende Erfahrung und die Details dazu gibt es im Sportblog. Mir hat die Teilnahme zwei Dinge aufgezeigt. Zum einen, dass ich das tatsächlich schaffen konnte. Zum anderen aber auch, dass meine sportliche Leidenschaft woanders liegt und ich mich künftig wieder auf andere Projekte konzentrieren möchte. Manchmal muss man einfach etwas ausprobieren, um herauszufinden, ob es das Richtige ist.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen und einen tollen August!
Wenn du Feedback für mich hast, kannst du mir gerne direkt auf diese Mail antworten.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Datenkompression - Wie funktioniert das eigentlich?
Stell dir vor, du bist auf einer Party und aus den Boxen tönt Under Pressure von Queen. Gleichzeitig hörst du, wie jemand mit einem Business Mindset davon spricht, dass Diamanten nur unter Druck entstehen. Eine Situation wie diese ist perfekt, um mit einer spannenden Geschichte aus der Welt der Informatik beides miteinander zu verbinden. Und genau hier passt das Thema Datenkompression perfekt hinein.
Man spricht von Kompression, wenn man vorhandene Daten (Texte, Bilder, Musik, Video, etc.) verkleinert. Und zwar so, dass man die Daten immer noch nutzen, bzw. wiederherstellen kann. Denn es wäre natürlich einfach, von einem ganzen Buch einfach jede zweite Seite wegzuwerfen - die Größe der Daten würde sich direkt um 50% reduzieren. Allerdings würden wir dabei auch direkt den Informationsgehalt halbieren. Und das möchte man in der Regel nicht.
Aber es geht auch anders. Stell dir vor, du ziehst um und füllst Umzugskartons. In einen Karton packst du Kissen. Und vielleicht passt da ein großes Kissen hinein. Wenn du das Kissen aber zusammendrückst, sodass die Luft entweicht, dann passen in den gleichen Karton auch zwei oder vielleicht sogar drei Kissen hinein. Und wenn du diese zusammengedrückten, also komprimierten Kissen kräftig ausschüttelst, dann sind sie wieder ganz normal. Und genau sowas passiert mit Daten, wenn sie komprimiert werden.
In der Praxis hast du übrigens ständig mit Datenkompression zu tun. Ganz offensichtlich, wenn du eine komprimierte Datei aus dem Internet herunterlädst. Das sind beispielsweise ZIP-Dateien. Oder wenn du dir Videos auf YouTube oder Netflix anschaust oder Musik streamst oder dir digitale Fotos anschaust.
Die Idee, Daten zu komprimieren ist alt. Und die Gründe waren damals schon die selben wie heute. Man wollte (Speicher-) Platz und (Übertragungs-) Zeit sparen. Und so kann man die Stenografie, also die Kurzschrift, auch als eine Art von früher Datenkompression betrachten. Ich versuchte mich nach der Schule an einer Ausbildung als Bürokaufmann und damals gehörte Stenografie noch zum Lehrplan. Es ging dabei darum, mit einem besonderen Alphabet und vielen Regeln besonders kompakt und damit auch sehr schnell schreiben zu können. Zu Zeiten, in denen es noch keine Diktiergeräte gab, war sowas sehr hilfreich im Büro oder bei Gericht, wenn Protokolle mitgeschrieben werden mussten. Und nur der Vollständigkeit halber: Ich habe die Ausbildung und auch das Erlernen der Stenografie damals nicht abgeschlossen.
Der Huffman-Code
Aber in diesem Artikel soll es um die Kompression von digitalen Daten gehen. Und das begann in den 1940er und 1950er Jahren. Eine wichtige theoretische Grundlage schuf damals Claude Shannon und der spielte auch schon in der letzten Ausgabe der Anomalie eine wichtige Rolle. Auf Shannon geht nämlich auch unser Verständnis von Entropie zurück.
Nach den Ideen aus Shannons Arbeit entstanden erste Algorithmen, mit denen Daten effizienter codiert, also in eine für den Computer verständliche Form gebracht werden. Denn wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Daten für einen Computer immer nur aus Binärcode bestehen. Der von David A. Huffman im Jahr 1952 entwickelte Huffman-Code sorgt dafür, dass alle Symbole so codiert werden, dass häufige Zeichen kürzere Codes erhalten. Dafür wird der Text vorab analysiert, um die jeweiligen Häufigkeiten zu ermitteln.
Und damit kann man richtig viel Speicherplatz sparen. Huffman entwickelte sein Kodierungsverfahren damals übrigens als Student im Rahmen einer Studienarbeit. Der Huffman-Code wird übrigens auch heute noch verwendet - oftmals in Kombination mit anderen Kompressionsverfahren.
Lauflängencodierung
Ein weiteres, recht einfaches Verfahren, ist die Lauflängencodierung. Ich konnte keine genauen Quellen über deren Ursprung finden. Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 1967, ich kann mir aber gut vorstellen, dass man schon davor damit gearbeitet hat. Denn das Prinzip ist wirklich einfach. Bei der Lauflängencodierung (Run-length encoding, kurz RLE) werden bei Sequenzen von gleichen Symbolen einfach die Anzahl der Symbole und das Symbol gespeichert. Aus AAAAAA wird also 6A.
Und das kann bei den passenden Daten eine enorme Kompression bewirken. Beispielsweise bei der Übermittlung von Fax Nachrichten. Denn diese haben keine Graustufen und daher kommt es häufig vor, dass eine Pixel-Zeile nur schwarz oder weiß ist oder es sehr lange einfarbige Sequenzen gibt. RLE war ein frühes Kompressionsverfahren für Bilder der direkte Vorgänger des farbigen und deutlich effizienteren GIF-Formats. Beim Fax ist die RLE heute übrigens immer noch im Einsatz.
Lempel & Ziv
Ende der 1970er Jahre erfolgte dann die nächste bedeutende Entwicklung. Abraham Lempel und Jacob Ziv entwickelten ein Wörterbuch-basiertes Kompressionsverfahren. Ihre Algorithmen LZ77 und LZ78 hatten keine besonders einprägsamen Namen, aber sie waren revolutionär und schufen die Basis für viele Technologien, die wir auch heute noch nutzen. Die Idee von Lempel und Ziv war einfach. Sie analysierten die Quelldaten und suchten nach wiederkehrenden Mustern. Das wären bei einem Text einzelne Worte. Aus diesen Mustern bauten sie eine Liste, also das sogenannte Wörterbuch, auf und dann ordneten sie den einzelnen Mustern kurze Codes zu.
Analog zur Grundidee von Huffman wählte man auch hier den kürzesten Code für das längste Muster. Und letztendlich wurden dann alle Muster in den ursprünglichen Daten durch die Codes ersetzt. In der Regel war dann die Kombination aus erstelltem Wörterbuch und den codierten Daten deutlich kleiner, als die ursprünglichen Daten. Die Wörterbuchmethode konnte natürlich auch noch mit der Huffman-Codierung verbunden werden, um eine noch höhere Kompressionsrate zu erreichen. An der Stelle möchte ich auch auf Folge 108 der Digitalen Anomalien verweisen. Dort erzähle ich nämlich die Geschichte vom GIF-Format, bei dem der LZW Algorithmus, eine Weiterentwicklung von LZ78, eine große Rolle spielt.
In den Jahren nach Lempel und Ziv gab es zahlreiche Weiterentwicklungen, die die Datenkompression immer mehr verbesserten. Neben höheren Kompressionsraten wurden die Algorithmen vor allem schneller und effizienter im Umgang mit notwendigem Speicher und CPU Last.
Verlustbehaftete Kompression
Der Huffman-Code, LZ78 und darauf basierende Verfahren haben eine Sache gemeinsam. Sie sind verlustfrei, was heißt, dass die ursprünglichen Daten jederzeit exakt und ohne Informationsverlust wiederhergestellt werden können. Und das ist in vielen Fällen gewünscht und auch notwendig. Bei einem Text möchte ich nicht, dass Buchstaben verdreht sind oder gar ganze Worte fehlen. Und wenn ich ein Computerprogramm komprimiere, dann soll kein einziges Bit am Ende anders sein - denn sonst stürzt das Programm womöglich ab oder verweigert komplett seinen Dienst.
Es gibt aber auch Fälle, in denen man mit einem gewissen Verlust an Daten ganz gut leben kann. Das prominenteste Beispiel dafür ist sicher die mp3 Datei. Es wurde Anfang der 1980er Jahre entwickelt und schließlich 1991 veröffentlicht. Zwei Jahre später folgte die Standardisierung. Das Format überraschte mit Audiodateien, die ziemlich gut klangen, aber nur einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe hatten. Wie war das möglich?
Bei der mp3 orientierte man sich damals an Forschungsergebnissen aus der Psychoakustik. Vereinfacht gesagt ging es darum, all die Frequenzen aus den Dateien herauszufiltern, die ein Mensch nicht hören kann. Beispielsweise weil die Frequenz zu hoch ist oder weil sie von anderen, dominanten Frequenzen überlagert wird. Durch diese Filterung entstand in einem ersten Schritt eine Datei mit viel weniger Informationen. Diese werden anschließend mit einer modifizierten Version des Huffman-Codes weiter komprimiert. Das Ergebnis ist eine Verkleinerung auf 1/10 der ursprünglichen Größe
Bei Bildern und Videos gibt es ebenfalls spezialisierte und verlustbehaftete Kompressionsverfahren. Das bekannte JPG Format für Fotos führt beispielsweise eine verlustbehaftete Vorverarbeitung durch, bei der benachbarte Pixel mit ähnlichen Farben zusammengefasst werden - so entstehen Muster, die später effizient verlustfrei komprimiert werden. Außerdem werden Details entfernt, die das menschliche Auge kaum wahrnehmen kann.
Und schließlich gibt es noch Videos. Ohne Kompression wäre ein Spielfilm mehrere hundert Gigabyte groß: zu viel für Streaming oder Blu-rays. Videokompression ist ziemlich komplex und nutzt einige Verfahren, die auch bei der Bildkompression genutzt werden. Dazu kommt noch der Ansatz, dass man die Veränderung zwischen zwei einzelnen Frames analysiert und nur diese Änderung speichert. In Filmen ist es oft so, dass sich nicht das komplette Bild ändert. Beispielsweise bei einer Szene, in der eine Figur etwas erzählt. Die Figur bewegt sich, aber der Großteil des Bildes ist statisch. In so einem Fall würde es ausreichen, nur den sich bewegenden Teil zu speichern und den Rest wiederzuverwerten. In der Praxis ist das natürlich etwas komplizierter.
Fazit
Man kann heute also sagen, dass Kompression eine große Rolle spielt und zumindest unsichtbar ihren Dienst tut. Es gibt auch noch ständig Forschung und neue Entwicklungen und man darf gespannt sein, was für neue Verfahren noch entstehen werden. Ich glaube, dass man für besondere Arten von Daten sicher noch spannende Algorithmen entwickeln wird, analog zur Erfindung der mp3 in den 1990er Jahren. Bei der verlustfreien Kompression gibt es allerdings theoretische Grenzen. Daten können nämlich nicht unendlich komprimiert werden. Der maximale Kompressionsfaktor leitet sich theoretisch aus der Entropie der Daten gemäß der Informationstheorie nach Shannon ab. Denn je höher die Entropie der Daten ist, desto unvorhersehbarer, also zufälliger sind die Daten und desto weniger Redundanz ist vorhanden, die für Kompression genutzt werden könnte. Und bei einem hohen Zufall wird es wenige Muster geben, die für Kompression genutzt werden können.
Quellen
- Datenkompression in der Wikipedia
- Huffman-Code in der Wikipedia
- Lauflängencodierung in der Wikipedia (en)
- Simulator für einen Huffman-Baum
- IEEE Artikel über Lauflängencodierung aus dem Jahr 1967
Bedeutende Frauen der Informatik: Brenda Laurel
Brenda Laurel begann bereits 1977, in der aufkommenden Spiele- und Softwarebranche zu arbeiten – zu einer Zeit, als außerhalb akademischer Kreise kaum jemand über das Potenzial interaktiver Medien nachdachte, und noch weniger über deren Wirkung auf unterschiedliche Zielgruppen.
Ursprünglich hatte sie ganz andere Pläne. Laurel studierte Fine Arts mit einem Schwerpunkt auf Theaterwissenschaften und träumte von einer Karriere als Regisseurin oder Schauspielerin. Doch bald erkannte sie, dass eine künstlerische Laufbahn zwar erfüllend, aber finanziell unsicher war. Also machte sie sich auf die Suche nach einem alternativen Weg – und fand ihn in der Welt der Technologie.
Die Gelegenheit bot sich ihr 1977, als sie bei der von einem Freund gegründeten Firma einstieg. Dort entwickelte sie interaktive Märchen und Lernprogramme für Kinder – ein früher Vorbote ihrer späteren Arbeit, in der sie sich immer wieder mit der Schnittstelle zwischen Erzählung, Technologie und Mensch beschäftigte. In den folgenden Jahren war sie in zahlreichen namhaften Unternehmen tätig – darunter Atari, Apple, Citibank, Fujitsu Labs, Sony Pictures und Paramount New Media. Ihre Rollen reichten von Interface-Designerin über Design- und Beratungstätigkeiten bis hin zur Projektleitung. Dabei wurde sie zu einer anerkannten Expertin für das Design von interaktiven Systemen, die nicht nur funktional, sondern auch emotional ansprechend sein sollten.
Forschung bei Interval – Warum spielen Mädchen nicht?
Von 1992 bis 1997 arbeitete Brenda Laurel bei der renommierten Interval Research Corporation in Palo Alto – einem von Paul Allen mitbegründeten Thinktank. Dort leitete sie eine umfassende Studie zur Frage, warum Mädchen und Frauen so wenig Computerspiele spielten. Das Ergebnis war überraschend: Brutalität oder Wettbewerbselemente waren gar nicht die Hauptprobleme. Viel gravierender war das Fehlen authentischer Geschichten, emotionaler Tiefe und identifikationsfähiger Figuren. Die damaligen Spiele sprachen die Erfahrungswelt vieler Mädchen schlichtweg nicht an.
Diese Erkenntnisse stellten die bis dahin männlich geprägte Spielekultur radikal in Frage und trugen maßgeblich dazu bei, dass Genderforschung in der Game-Industrie überhaupt ernst genommen wurde.
1996 gründete Laurel das Unternehmen Purple Moon, um die Erkenntnisse ihrer Forschung in konkrete Produkte zu überführen. Das Studio entwickelte eine Reihe von Spielen rund um die Figur Rockett, ein Mädchen, das sich mit den alltäglichen Herausforderungen des Teenager-Daseins auseinandersetzt. Die Spiele setzten auf narrative Tiefe statt auf Highscores, auf Beziehungsdynamiken statt auf Gewalt – ein revolutionärer Ansatz in einer Branche, die damals noch weitgehend auf männliche Jugendliche zugeschnitten war.
Die Resonanz war groß. Viele Mädchen fühlten sich zum ersten Mal von einem Computerspiel verstanden. Auch Eltern und Pädagog:innen begrüßten die neuen Inhalte. Purple Moon wurde 2000 von Mattel übernommen – was zwar als kommerzieller Erfolg galt, aber auch das Ende der kreativen Freiheit des Projekts bedeutete. Mattel legte die Marke später allerdings wieder still, was von vielen als Rückschritt gesehen wurde.
Theorie und Praxis
Brenda Laurels Karriere war stets ein Spagat zwischen Forschung, Unternehmenspraxis und öffentlicher Kommunikation. Ihr TED Talk von 1998 gilt bis heute als wegweisend. Darin spricht sie nicht nur über Gender und Spiele, sondern über die tiefere Bedeutung von Interaktivität, Immersion und der Verantwortung von Entwickler:innen gegenüber ihrem Publikum.
Laurel promovierte an der Ohio State University in Theaterwissenschaften, beschäftigte sich intensiv mit Mensch-Computer-Interaktion und setzte sich früh für einen nutzerzentrierten Designansatz ein, der später als Human-Centered Design bekannt wurde. Sie war Professorin an mehreren Universitäten, darunter der University of California Santa Cruz, und engagierte sich in zahlreichen Gremien rund um Designethik, Medienpädagogik und technologische Verantwortung.
Vermächtnis
Vielleicht half ihr ihr Hintergrund im Theater, um Computerspiele nicht nur als Produkte, sondern als Inszenierungen zu verstehen – mit Dramaturgie, Publikum und Wirkung. Brenda Laurel war eine der ersten, die das Digitale als kulturellen Raum begriff, in dem Repräsentation, Emotion und gesellschaftliche Normen eine Rolle spielen.
Ihr Einfluss ist heute spürbar. Aktuelle Spiele wie Life is Strange, The Last of Us oder Horizon: Zero Dawn erzählen komplexe Geschichten mit starken, vielschichtigen weiblichen Figuren. Wie viel davon direkt auf Laurels Forschung zurückgeht, lässt sich schwer messen – aber ihr Beitrag war ohne Zweifel ein entscheidender Impuls auf dem Weg dorthin.
Videospiele sind heute im Mainstream angekommen und übertreffen die Filmindustrie in vielen Märkten mittlerweile deutlich beim Umsatz. Und wie bei so vielen Dingen, die mit Technik zu tun haben, waren auch hier Frauen lange nur eine Randerscheinung. Dank der Pionierleistung von Frauen wie Brenda Laurel hat sich das geändert. Ihre Geschichte zeigt darüber hinaus auch, dass die Informatik wirklich sehr vielschichtig ist und dass es in diesem Bereich eine unglaubliche Vielfalt von Professionen gibt. Von der klassischen Informatik über Mathematik bis hin zu Menschen, die auf diesen technischen Grundlagen sprichwörtlich neue Welten erschaffen.
Ich mag dieses Zitat von ihr besonders:
"Reality has always been too small for the human imagination. We're always
trying to transcend."
Quellen
- https://en.wikipedia.org/wiki/Brenda_Laurel
- https://www.atariwomen.org/stories/brenda-laurel/
- https://www.wired.com/1993/02/brenda/
- Ihr bekannter TED Talk
Links und Leseempfehlungen
Hirnimplatate Ist das die Zukunft und eine Hoffnung für Menschen, die beispielsweise nicht sehen können oder eine sonstige Einschränkung haben? Das Thema ist spannend und klingt teilweise hoffnungsvoll, teils nach Science Fiction.
ASCII Art Ich liebe Retro Computing und Erinnerungen an die alten Zeiten. Als ich in den 1990ern so richtig mit Computern loslegte, da fanden sich auf Disketten und in Mailboxen in Textdateien oftmals kleine Kunstwerke, die nur aus Textsymbolen bestanden. Diese Seite hat eine große Sammlung und läd zum Stöbern und Staunen ein.
Auf die Größe kommt es an Schon im Intro von Star Trek wird gesagt, dass das All unendliche Weiten umfasst. Diese kleine Simulation gibt ein Gefühl dafür, wie groß die Entfernungen in unserem Sonnensystem sind. Ich fand das sehr beeindruckend.
Mathe als Kunst Mathematische Probleme werden oft mit Formeln gelöst. Aber es geht auch anders, wie diese Sammlung zeigt. Und zwar rein grafisch.
Fliegende Toaster Falls du in den 1990ern einen Windows PC hattest, dann kannst du dich vermutlich an fliegende Toaster erinnern. Es gab damals nämlich einen legendären Screen Saver namens After Dark. Genau genommen handelte es ich dabei um eine ganze Sammlung von Bildschirmschonern. Und einer davon war Flying Toasters. Und das kann man sich jetzt nochmal im Browser anschauen. Altere Leute werden dabei nostalgisch, jünger schütteln vermutlich einfach nur den Kopf.
Neulich im Podcast & im Internet
Digitale Anomalien #107: Die berühmteste Büroklammer der Welt
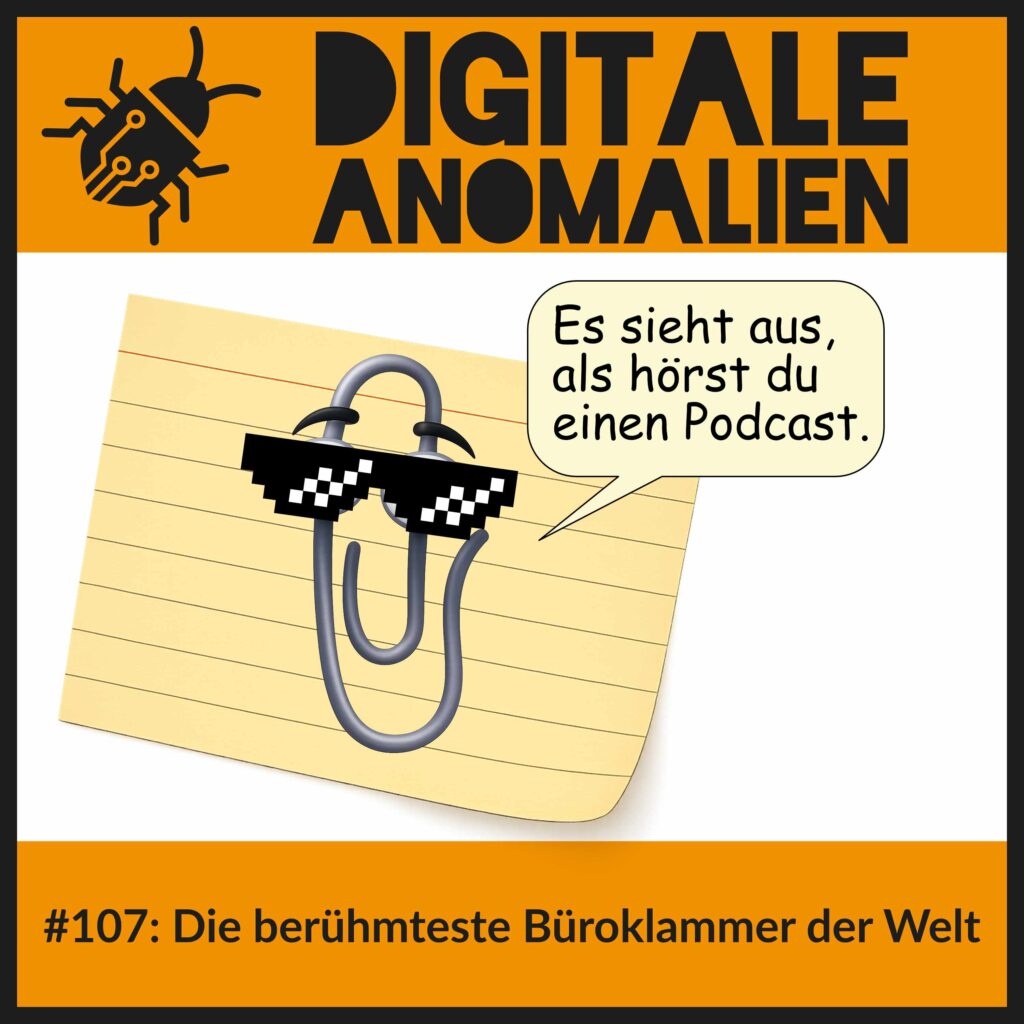 In den frühen 1990er Jahren versuchte Microsoft, seine Software einsteigerfreundlicher zu gestalten. Ein Ergebnis war Microsoft Bob, das eine radikal vereinfachte Oberfläche für Windows mitbrachte. Doch dieser Ansatz scheiterte am Markt. Eine der damals entwickelten Technologien war Microsoft Agents, ein Framework für persönliche Assistenten, die stets mit Rat und Tat zur Seite stehen sollten.
In den frühen 1990er Jahren versuchte Microsoft, seine Software einsteigerfreundlicher zu gestalten. Ein Ergebnis war Microsoft Bob, das eine radikal vereinfachte Oberfläche für Windows mitbrachte. Doch dieser Ansatz scheiterte am Markt. Eine der damals entwickelten Technologien war Microsoft Agents, ein Framework für persönliche Assistenten, die stets mit Rat und Tat zur Seite stehen sollten.
Die Idee war gut, doch die Umsetzung genügte nicht den Bedürfnissen der Nutzer. Ihre Premiere feierten die Assistenten im Jahr 1996 mit der Veröffentlichung von Office 97, wo es zehn verschiedene Assistenten zur Auswahl gab. Am prominentesten war allerdings eine kleine Büroklammer namens Clippy, da es sich dabei um die Standardeinstellung handelte.
In Deutschland wurde Clippy als „Karl Klammer” bekannt. Und Clippy war vor allem eines: nervig. Der Assistent war nicht personalisierbar und kam immer und immer wieder mit den gleichen Vorschlägen um die Ecke. Nach wenigen Jahren verabschiedete sich Microsoft wieder von der Idee der Assistenten – und damit auch von Clippy. Heute ist Clippy ein Internetmeme und taucht immer wieder irgendwo auf.
Digitale Anomalien #108: Das bekannteste Grafikformat der Welt
 Die Geschichte des GIF Formats reicht zurück bis in die 1970er Jahre. Damals wurde nämlich der Grundstein für einen Kompressionsalgorithmus gelegt, der im GIF Format verwendet wurde. Dieser Algorithmus, der LZW Algorithmus wurde damals patentiert und das sorgte ab Mitte der 1990er Jahre für einen großen Aufschrei. Bis dahin wurde der LZW Algorithmus und das GIF Format nämlich stets kostenfrei verwendet und vor allem das GIF Format war damals schon zu einem de facto Standard im noch jungen World Wide Web geworden.
Die Geschichte des GIF Formats reicht zurück bis in die 1970er Jahre. Damals wurde nämlich der Grundstein für einen Kompressionsalgorithmus gelegt, der im GIF Format verwendet wurde. Dieser Algorithmus, der LZW Algorithmus wurde damals patentiert und das sorgte ab Mitte der 1990er Jahre für einen großen Aufschrei. Bis dahin wurde der LZW Algorithmus und das GIF Format nämlich stets kostenfrei verwendet und vor allem das GIF Format war damals schon zu einem de facto Standard im noch jungen World Wide Web geworden.
Diese Folge der Digitalen Anomalien erzählt die Geschichte des GIF Formats und erklärt, welche Rolle damals Softwarepatente gespielt haben. Außerdem wird geklärt, wie man GIF eigentlich korrekt ausspricht. Nun ja, es wird zumindest versucht.
Zeitflimmern #9: Armee der Finsternis
 In dieser Folge geht es um Armee der Finsternis aus dem Jahr 1992.
In dieser Folge geht es um Armee der Finsternis aus dem Jahr 1992.
Eine Shotgun und eine Kettensäge? Sind unsere Zeitreisenden wirklich im Mittelalter gelandet? Als sich schließlich Skelette aus ihren Gräbern erheben, könnte es brenzlig werden.
Unsere neunte Episode dreht sich um den Film Armee der Finsternis! Ash Williams wird durch dämonische Magie ins Mittelalter befördert. Mitsamt Kettensägenarmprothese und Shotgun, muss er sich gegen die Armee der Finsternis zur Wehr setzen. Schafft Ash dieses und wird er die richtigen Worte finden um das Necronomicon aus seiner Wiege zu nehmen? Findet es zusammen mit uns heraus!
Digital Future #83: Mehr Sicherheit, weniger Freiheit? Wie NIS2 & CRA die IT verändern
In dieser Folge sprechen wir mit IT-Security-Experte Clemens Hübner über die zunehmende Regulierung im Bereich Cybersicherheit – und darüber, was sie für Unternehmen und Entwickler:innen bedeutet. Im Fokus stehen die EU-Richtlinien NIS2 und der Cyber Resilience Act (CRA). Bremst all das die Softwareentwicklung aus – oder sorgt es endlich für mehr Klarheit und Sicherheit?
Wir diskutieren die Chancen und Herausforderungen der neuen Vorgaben, warum Security mehr als nur Compliance sein muss, und welche Best Practices Unternehmen jetzt umsetzen sollten. Clemens gibt außerdem eine klare Empfehlung: Früh anfangen. Systematisch vorgehen. Und Security nicht nur als Pflicht, sondern als Haltung verstehen.
Digital Future #84: Was steckt eigentlich hinter einer Unternehmenswebseite?
In dieser Episode wirft Wolfgang Schoch einen Blick hinter die digitale Fassade von inovex: Zu Gast ist Finn Oschmann, Technical Product Owner der Unternehmenswebseite. Finn berichtet, wie er die zentrale Onlineplattform auf WordPress-Basis technisch betreut, kontinuierlich weiterentwickelt und mit individuellen Features an die Bedürfnisse des Unternehmens anpasst. Dabei geht es nicht nur um Design und neue Funktionen – auch regelmäßige Performance-Checks und Sicherheitsüberprüfungen gehören zu seinen Aufgaben, um eine stabile und zuverlässige Webpräsenz sicherzustellen.
Wolfang und Finn sprechen außerdem über die Vorteile von WordPress als technologischer Basis: die große Verbreitung, die Flexibilität für technische Anpassungen und nicht zuletzt die einfache Bedienbarkeit für Redakteur:innen im Alltag. Finn gibt spannende Einblicke in die enge Zusammenarbeit mit Marketing, Design und anderen Teams – und zeigt, wie gute interne Abstimmung und technische Exzellenz Hand in Hand gehen, um aus einer Webseite ein echtes digitales Aushängeschild zu machen.
Digital Future #85: Technische Schulden: Zwischen notwendigem Übel und unsichtbarem Risiko
Technische Schulden kennt jedes IT-Team – doch wwie geht man damit um? Und was ist damit überhaupt gemeint? In dieser Folge sprechen Christian Rohmann (IT Operations), Christoph Erhard (Softwareentwicklung) und Simon Bachstein (Data Engineering) über technische Schulden aus ihren jeweiligen Fachperspektiven: von veralteter Infrastruktur über bewusste Kompromisse im Code bis hin zu wachsenden Anforderungen im Datenbereich.
Gemeinsam mit Wolfgang Schoch beleuchten sie Ursachen wie veraltete Tools, fehlende Tests oder schlechte Datenqualität und diskutieren, warum technischer Schuldenstand schwer messbar, aber riskant ist. Dabei geht es nicht nur um Technik – sondern auch um Verantwortung, Kommunikation und langfristige Teamgesundheit.
Mit vielen praxisnahen Beispielen und konkreten Tipps zeigen sie, wie ein pragmatischer Umgang mit technischer Schuld gelingen kann – von Code Reviews über CI/CD bis hin zu einer nachhaltigen Kultur der Qualität.
Last, but not least
Die Kaffeekasse Die Anomalie und der Podcast sind kostenlos und entstehen in meiner Freizeit. Hauptsächlich, weil mir das viel Spaß macht. Ich habe aber eine kleine virtuelle Kaffeekasse auf der Plattform Ko-Fi und freue mich da über den ein oder anderen virtuellen Kaffee, den ich selbstverständlich zeitnah in ein koffeinhaltiges Heißgetränk umwandeln werde. https://ko-fi.com/herrschoch
Twitch Einmal in der Woche bin ich live auf Twitch und rede da über die aktuellen Techniknews der Woche. In der Regel ist das am Mittwoch gegen 18 Uhr. https://www.twitch.tv/herrschoch
Themenvorschläge Welches Thema würde dich denn in einer der nächsten Ausgaben interessieren? Schreibs mir gerne als Antwort auf diese Email.
PS: Füge meinen Absender hallo@digitaleanomalien.de deinen Kontakten hinzu, damit der Newsletter auch zuverlässig bei dir ankommt und nicht im Spam landet.

