#9 - September 2025
Themen in dieser Ausgabe:
- Neuigkeiten
- Hello World!
- Bedeutende Frauen der Informatik: Frances Elizabeth Allen
- Links und Leseempfehlungen
- Neulich im Podcast & im Internet
- Last, but not least
Hallo ,
wenn man eine neue Programmiersprache lernt, dann ist das erste Programm, das man damit schreibt, in der Regel ein "Hello World"-Programm. Die Geschichte hinter dieser Tradition erfährst du im ersten Artikel dieser Ausgabe.
Apropos Tradition: Auch dieses Mal gibt es wieder das Porträt einer bedeutenden Informatikerin. Frances "Fran" Elizabeth Allen hat in ihrem langen Leben einige bedeutende Dinge erreicht, die bis heute nachwirken. Ich hoffe, dass dich ihre Geschichte genauso inspiriert wie mich.
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Für mich persönlich steht Ende Oktober erst einmal ein längerer Urlaub an, auf den ich mich schon sehr freue. Die nächste Ausgabe der Anomalie erscheint daher erst Ende November. Beim Podcast werde ich vermutlich auch eine oder zwei Folgen pausieren.
Es gibt aber bereits einige spannende Pläne für den Rest des Jahres. Aktuell bin ich mit der Terminfindung für zwei tolle Gäste beschäftigt, auf die ich mich schon sehr freue. Außerdem werde ich bei zwei Adventskalendern jeweils einen Beitrag beisteuern, worauf ich mich ebenfalls sehr freue.
Ich hoffe, du bist gut in den Herbst gestartet. Jetzt bricht ja so langsam die Jahreszeit an, in der man oft mehr Zeit zu Hause verbringt. Das ist natürlich auch ideal, um mal im Discord vorbeizuschauen und der Community hallo zu sagen. ;)
Ende November wird es auch wieder auf Twitch aktiver werden. In den letzten Wochen ist dort aus Zeitmangel nur wenig passiert.
Wenn du Feedback für mich hast, kannst du mir gerne direkt auf diese Mail antworten.
Herzliche Grüße
Wolfgang
Hallo Welt!
Wenn man eine neue Sprache lernt, beginnt man mit einfachen Wörtern, mit denen man kurze Sätze bilden kann. Beispielsweise “My name is Wolfgang” oder “Nice to meet you.”
Bei Programmiersprachen ist das nicht anders. Und falls du selbst schon mal eine Programmiersprache gelernt hast oder auch nur darüber gelesen hast, dann kennst du sicher diese einfachen ersten Programme, die es in jeder Programmiersprache gibt.
Die Rede ist von den Hello-World-Programmen. Das sind kleine Programme, die den Text “hello world” ausgeben. Im Internet gibt es Sammlungen solcher Programme für so ziemlich jede Programmiersprache. Wenn man darin stöbert, dann fällt schnell auf, wie unterschiedlich die einzelnen Sprachen doch sind.
In manchen Sprachen wie beispielsweise Python reicht eine einzelne Zeile aus:
print('hello world')
In anderen Programmiersprachen benötigt man deutlich mehr Code, um ein lauffähiges Programm zu erhalten. Ich habe viele Jahre beruflich mit Java gearbeitet und da würde ein minimales Programm so aussehen:
class Hallo {
public static void main( String[] args ) {
System.out.println("hello world");
}
}
Aber woher kommt eigentlich diese Tradition, bei einer Programmiersprache mit diesen Hello-World-Programmen als Beispiel anzufangen? Die Ursprünge gehen auf Brian W. Kernighan zurück. Der ist ein kanadischer Informatiker und er arbeitete ab Ende der 1960er Jahre bei den Bell Labs. Dort war er im UNIX-Team und er entwickelte dort viele kleine UNIX-Programme, die auch heute noch genutzt werden. Unter anderem war er Mitentwickler der Programmiersprache awk, die es auch heute noch auf UNIX und Linux gibt. Das “k” in awk steht für Kernighan.
Programmiersprachen sind generell ein Thema, das ihn interessiert. Und so schreibt er im Jahr 1972 bei Bell ein internes Tutorial für die Programmiersprache B mit dem Titel A Tutorial Introduction to the Language B. Und darin befindet sich ein Beispielprogramm, das die Worte “hello world” ausgibt:
main( ) {
extrn a, b, c;
putchar(a); putchar(b); putchar(c); putchar('!*n');
}
a 'hell';
b 'o, w';
c 'orld';
Die Sprache B ist eine Weiterentwicklung von BCPL. Und es wird berichtet, dass es dafür bereits in den 1960er Jahren ein Programmbeispiel gab, dass die Worte “hello world” ausgab. Es ist gut möglich, dass Kernighan davon inspiriert wurde.
Doch weder das Programmbeispiel aus BCPL noch das Beispiel aus dem B Tutorial erhalten eine große Aufmerksamkeit. Übrigens genau wie die beiden Programmiersprachen. Deren großer Verdienst ist es aber, aber, die Grundlage für eine weitere, äußerst erfolgreiche Programmiersprache zu schaffen: C.
Und im Jahr 1978 schrieb Kernighan zusammen mit Dennis Ritchie ein Lehrbuch zur Programmiersprache C. Es trug den Titel The C Programming Language. Darin befand sich ebenfalls ein Hello-World-Beispiel:
main( ) {
printf("hello, world");
}
C entwickelt sich schnell zu einer populären und wichtigen Programmiersprache und so wundert es auch nicht, dass sich das Buch stark verbreitete – und mit ihm das Programmierbeispiel. Und das ist bis heute so geblieben. Viele Programmierumgebungen (IDE – Integrated Development Environment, also spezialisierte Editoren zum Programmieren) erstellen direkt ein Hello-World-Programm, wenn man ein neues Projekt anlegt. Ich mag solche Traditionen, weil sie an die Ursprünge der Programmierung erinnern und Jahrzehnte überdauert haben. Und vermutlich ist “hello world” das am häufigsten geschriebene Programm der Welt.
Quellen
- Der Hello-World-Artikel in der Wikipedia (EN)
- Eine lange Liste von Hello-World-Programmen
- Artikel über Brian W. Kernighan in der Wikipedia
Bedeutende Frauen der Informatik: Frances Elizabeth Allen
Wenn jemand etwas zum ersten Mal schafft, dann hat das eine ganz besondere Wirkung. Es beweist, dass es überhaupt möglich ist. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der britische Läufer Roger Bannister, der am 6. Mai 1954 eine Meile in unter vier Minuten lief. Nur wenige Wochen danach wurde Bannisters Rekord gebrochen. Anderen Läufern war nun klar, dass man überhaupt so schnell laufen kann. Die Leistung von Bannister war eine große Inspiration.
Die Informatikerin Frances “Fran” Elizabeth Allen ist ebenfalls so eine inspirierende Person. Denn sie hat in ihrer Laufbahn auch Dinge erreicht, die vor ihr keine Frau erreicht hatten. Frances E. Allen wurde am 4. August 1932 in Peru, New York, geboren. Sie wuchs zusammen mit fünf Geschwistern auf einer Farm ohne Elektrizität auf. Schon als junges Mädchen begeisterte sie sich für Mathematik und Naturwissenschaften. Sie erwarb 1954 einen Bachelor in Mathematik und unterrichtete danach an der High School in Peru, die sie selbst als Schülerin besucht hatte. Das Unterrichten machte ihr Spaß. Nach zwei Jahren unterbrach sie ihre Lehrtätigkeit, um weiter zu studieren und schließlich 1957 den Masterabschluss in Mathematik zu erlangen. Und danach wollte sie eigentlich wieder an die Schule zurückkehren.
Ihr Studium hatte sie durch einen Studienkredit finanziert. Und um den abzubezahlen, nahm sie einen Job bei IBM an. Eigentlich wollte sie dies nur vorübergehend machen und danach wieder zurück an die Schule, um dort zu unterrichten. Doch aus der vorübergehenden Tätigkeit wurde eine über vier Jahrzehnte dauernde Karriere.
Sie begann 1957 bei IBM Research zu arbeiten und hielt anfangs intern bei IBM Kurse, in denen sie anderen Mitarbeitenden die Programmiersprache Fortran beibrachte. Vorkenntnisse in der Programmierung hatte sie keine, aber hier kam ihr großes Interesse für Mathematik zum Tragen. Fortran gilt als klare, mathematisch geprägte Sprache. Der Name Fortran steht übrigens auch für Formula Translation (“Formel-Übersetzung”). Die Sprache wurde 1957 von IBM veröffentlicht und verbreitete sich in den folgenden Jahren sehr stark. Daher gab es bei IBM auch ein großes Interesse, die Sprache und das Wissen darum zu fördern. Und Frances E. Allen brachte mit ihren Talenten in Mathematik und Didaktik alles mit, was es dafür brauchte.
Doch es blieb nicht bei den Fortran-Kursen. Sie begann im Bereich der Compilerentwicklung und -optimierung zu arbeiten und in diesem Rahmen war sie an einigen bedeutenden IBM Projekten beteiligt. Ein Compiler ist ein Programm, das ein vom Menschen geschriebene Quelltexte (beispielsweise in Fortran) in die Form übersetzt, die ein Computer versteht. Diese Form nennt man Maschinensprache. Das ist ziemlich anspruchsvoll, da ein Compiler bei diesem Übersetzungsvorgang das Programm auch noch so optimieren muss, dass es möglichst effizient ausgeführt werden kann. Frances E. Allen arbeitete beispielsweise in den Supercomputerprojekten Stretch und Harvest, die IBM für die Kryptoanalyse bei der NSA entwickelte.
Während dieser Zeit betrat sie in vielerlei Hinsicht Neuland. Parallel zu ihrer Arbeit schrieb sie auch viele wissenschaftliche Aufsätze über diese neuen Erkenntnisse. So machte sie sich auch einen Namen in der Forschung. Ihr Fachgebiet wurde die Compilerentwicklung und viele Konzepte, die sie damals entwickelte, bilden auch heute noch die Basis für moderne Compiler.
Neben ihrer technischen Brillanz war Frances Allen eine leidenschaftliche Mentorin. Sie setzte sich innerhalb von IBM stark für Frauen in technischen Berufen ein und unterstützte zahlreiche Nachwuchstalente. Ihr Engagement trug dazu bei, dass immer mehr Frauen den Weg in die Informatik fanden.
Im Jahr 1989 wurde sie die erste weibliche IBM Fellow. Das ist die höchste Karrierestufe, die man bei IBM im technischen Bereich erreichen kann. Als Fellow hat man bei IBM große persönliche Freiräume und kann beispielsweise das eigene Forschungsgebiet frei wählen. IBM stiftete zu ihren Ehren im Jahr 2000 den Frances E. Allen Women in Technology Mentoring Award.
Frances E. Allen ging 2002 offiziell in den Ruhestand. Sie setzte sich danach aber immer noch für die Belange von Frauen ein und trug den Titel eines IBM Fellow Emerita.
Und im Jahr 2006 wurde sie schließlich als erste Frau überhaupt mit dem Turing Award ausgezeichnet – der höchsten Ehrung in der Informatik. Das ist am ehesten mit dem Nobelpreis für Informatik vergleichbar. Sie bekam die Auszeichnung für ihre “bahnbrechenden Beiträge zur Theorie und Praxis der Compileroptimierung und Programmanalyse”.
Ein Jahr später rief IBM den Fran Allen Ph.D. Fellowship Award ins Leben, mit dem jährlich eine herausragende Doktorandin geehrt wird.
Sie starb im Jahr 2020 an ihrem 88. Geburtstag. Ihre Arbeit prägte die Welt, denn in unseren heutigen Computern und Programmen stecken überall noch Ideen von Frances E. Allen. Darüber hinaus hat sie viele weitere Frauen ermutigt und inspiriert und ich bin mir nicht sicher, welche Leistung von ihr höher zu bewerten ist.
Quellen
- Artikel in der Wikipedia
- IBM Fellow in der Wikipedia
- Frances E. Allen Award for Outstanding Mentoring
- Artikel bei Scientific Women
- Dossier bei IBM
- Oral History bei ETHW
- Artikel zum Turing Award
Links und Leseempfehlungen
YAML from Hell Es gibt viele Datenformate und manche sind für Menschen offenbar besser geeignet, da sie lesbarer sind. Ein Klassiker ist Markdown, mit dem sich Texte einfach formatieren lassen. Wenn es um Konfigurationsdaten geht, dann bevorzugen viele Leute YAML (Yet Another Markup Language). Dieser Blogartikel geht auf einige Eigenheiten von YAML ein und legt nahe, dass es vielleicht doch nicht das einfachste Format ist. Und im Discord gab es dazu noch dieses tolle Quiz als Ergänzung.
Klammeraffe Über das @-Zeichen gab es in Ausgabe #5 einen Artikel. Bei der BBC bin ich nun ebenfalls über einen aktuellen Artikel zu diesem Thema gestolpert.
Kompression In der letzten Ausgabe hatte ich erklärt, wie Datenkompression funktioniert. Hier gibt es eine schöne Visualisierung zum Deflate-Algorithmus, der in der bekannten zlib-Bibliothek verwendet wird.
Vibe Coding Beim Programmieren kommt man aktuell am Thema KI nicht vorbei. Das KI-gestütze Programmieren wird Vibe Coding genannt und besteht im Extremfall nur noch daraus, dass man einige Prompts in ein Sprachmodell eintippt und im besten Fall ein lauffähiges Programm erhält. Und das soll natürlich eine hohe Qualität haben und deutlich schneller und dadurch billiger entstehen. Die Realität sieht anders aus. Und diesen Artikel zum Thema fand ich ganz gut.
Neulich im Podcast & im Internet
Digitale Anomalien #110: Die Mutter aller Chatbots
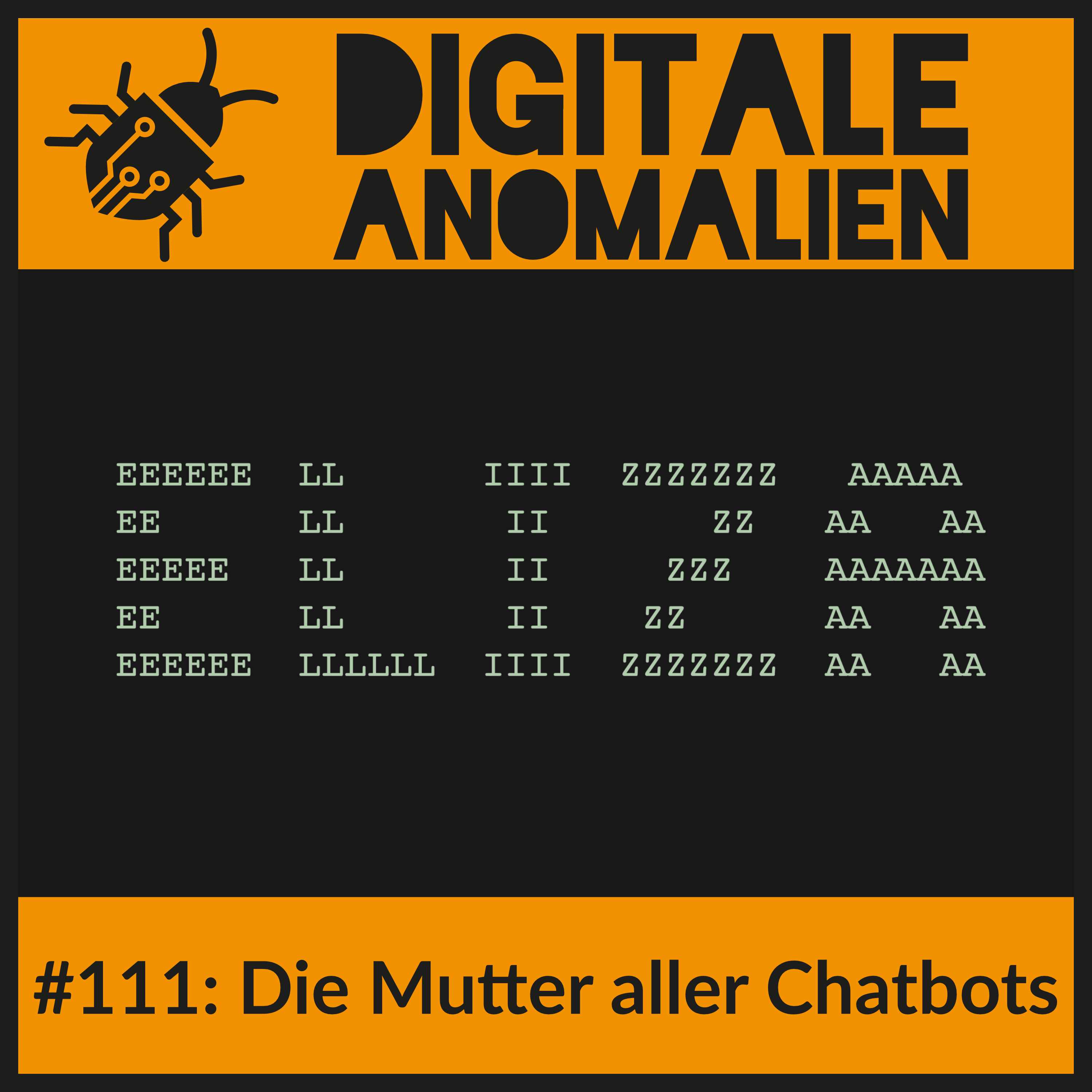
Damals wollte Joseph Weizenbaum erforschen, wie eine Kommunikation in natürlicher Sprache zwischen Mensch und Computer funktionieren könnte – und ob Menschen eine solche Kommunikationsform überhaupt annehmen würden. Sein Chatbot Eliza simulierte unter anderem einen Psychotherapeuten. Das funktionierte deutlich besser, als Weizenbaum vermutet hatte.
Die Menschen vertrauten dem Chatbot ihre intimsten Geheimnisse an. Selbst dann, als ihnen klar gesagt wurde, dass es sich lediglich um ein Programm handelt, das einfachen Regeln folgt. Weizenbaum war so geschockt, dass er zu einem Kritiker der allgemeinen Technologiegläubigkeit wurde.
Der nach diesem Chatbot benannte Eliza-Effekt beschreibt die Vermenschlichung von Technologie. In Zeiten von ChatGPT und Co. ist das aktueller denn je.
Digitale Anomalien #112: Legendäre Laptops (feat. ThinkPad-Museum)
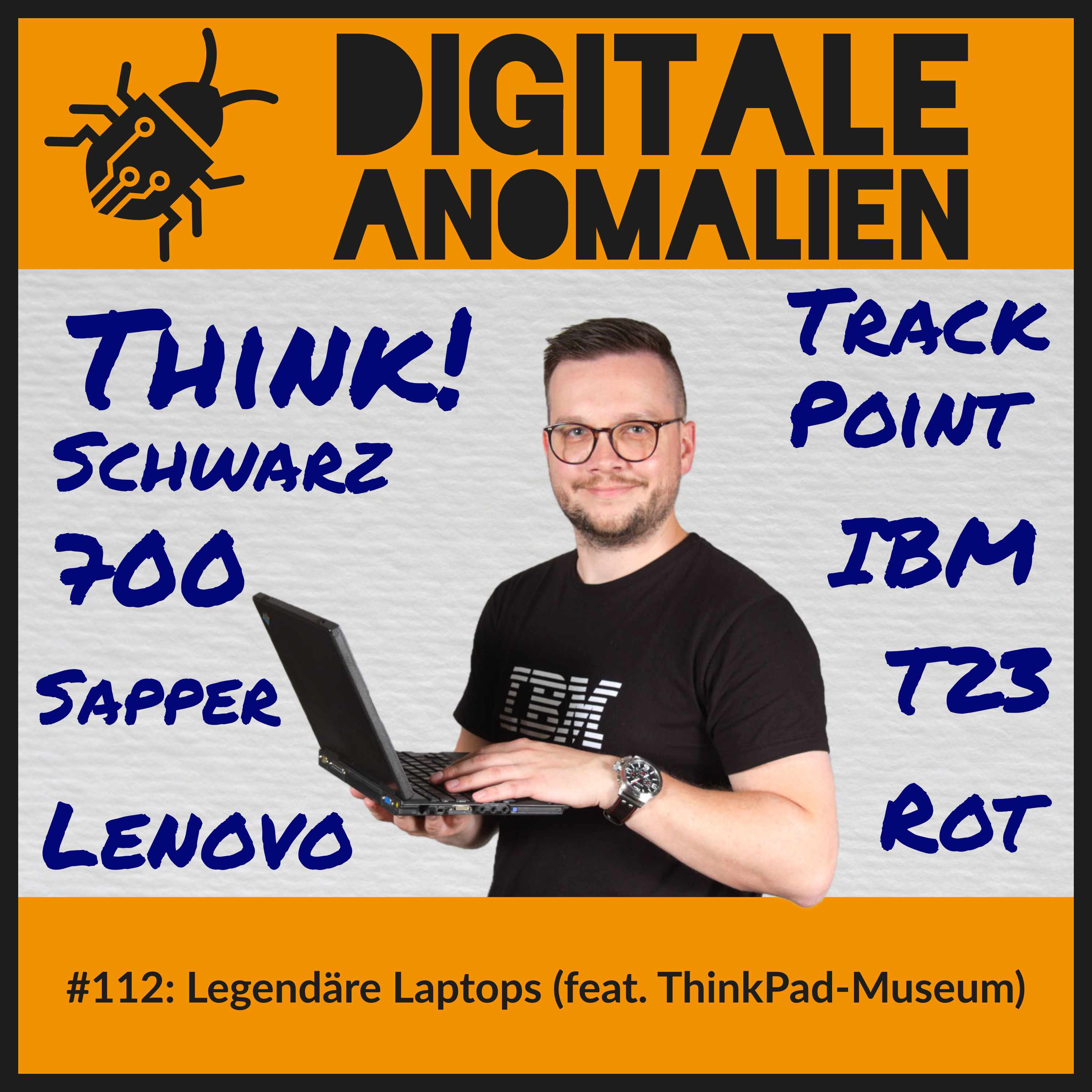
In dieser Folge unterhalte ich mich mit Christian Stankowic über sein außergewöhnliches Hobby. Christian sammelt nämlich Laptops. Und nicht irgendwelche, sondern ausschließlich Geräte vom Typ ThinkPad.
Diese Geräte wurden 1992 von IBM entwickelt und haben den Laptop-Markt maßgeblich beeinflusst. Mittlerweile gehört die Marke dem chinesischen PC-Hersteller Lenovo.
In dieser Folge begeben wir uns auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen der ersten ThinkPads. Christian hat viele Anekdoten und Fakten dazu mitgebracht.
Diese Folge ist Teil eines zweiteiligen Specials. Denn Christian hat ebenfalls einen Podcast. Im "ThinkPad-Museum"-Podcast spricht er monatlich über – na klar – ThinkPads. In der aktuellen Folge bin ich bei ihm zu Gast und erzähle eine Geschichte über fehlerhafte Akkus und die Probleme, die daraus entstehen können.
Digitale Anomalien #113: Unwirksame Passwörter
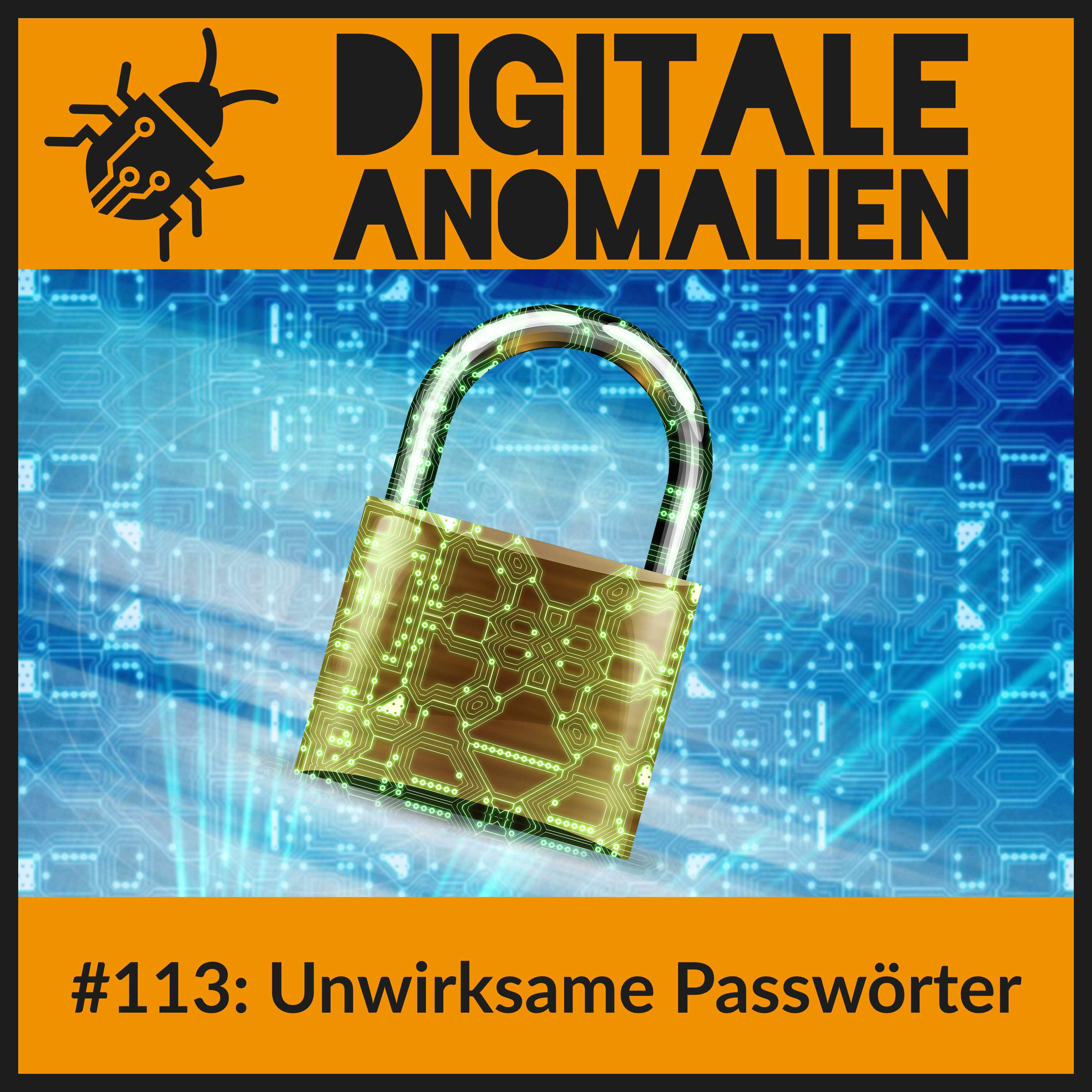
Im Jahr 2023 wurde bekannt, dass Microsoft Passwortlisten nutzt, um verschlüsselte Archive auf Malware zu überprüfen. Dieses Verfahren kommt wohl bei Microsoft SharePoint und dem E-Mail-Service des Unternehmens zum Einsatz. Bei E-Mails wird zusätzlich automatisiert geprüft, ob Passwörter im Text angegeben sind. Diese Verfahren sollen die Sicherheit erhöhen, indem die Verbreitung von Malware eingedämmt wird.
Neben diesen durchaus nachvollziehbaren Gründen ergeben sich hier aber noch weitere spannende Punkte. Was bedeutet es für unsere Privatsphäre, wenn vermeintlich vertrauliche Daten automatisiert überprüft werden? Sei es nun auf Malware oder inhaltlich.
Grobe Pixel #44: Legend of Kyrandia: Book One
 In dieser Folge reisen wir zurück ins Jahr 1992, als Westwood mit "The Legend of Kyrandia: Book One" ihr erstes großes Point and Click Adventure veröffentlichte. Zusammen mit Christian spreche ich über die Entstehungsgeschichte des Spiels von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung.
In dieser Folge reisen wir zurück ins Jahr 1992, als Westwood mit "The Legend of Kyrandia: Book One" ihr erstes großes Point and Click Adventure veröffentlichte. Zusammen mit Christian spreche ich über die Entstehungsgeschichte des Spiels von der ersten Idee bis zur Veröffentlichung.
Wir werfen einen Blick auf die Technik der damaligen Zeit und fassen die Story rund um Brandon, Malcolm und das Königreich Kyrandia zusammen.

Diesmal behandeln wir den Film Timeline aus dem Jahr 2003. Der Film basiert auf einem Roman von Michael Crichton.
Die Geschichte handelt von einer Gruppe Archäologen, die einen Hilferuf vom leitenden Professor erhält. Und dieser Hilferuf stammt aus dem Jahr 1357. Wie kam der Professor dorthin und wie sollen seine Freunde ihn retten?
In dieser Folge hatten wir Katrin vom Podcast IRMIMI zu Gast und es war uns ein Vergnügen zu dritt über den Film zu sprechen.
Digital Future #86: Vom Webdesigner zum Digital Product Designer
 UX ist mehr als schöne Buttons: Mit Gast Uwe Thimel geht es diesmal zurück in die Dotcom-Ära, als der "Webdesigner" noch alles in Personalunion machte, und zeichnen den Weg zu spezialisierten Rollen für UX, UI und Frontend nach. Warum Kunden UX oft fälschlich auf das sichtbare Interface reduzieren, weshalb eine frühe Investition in UX bares Geld spart und ob der Begriff "Digital Product Design" nicht treffender wäre – all das haben wir in dieser Folge besprochen.
UX ist mehr als schöne Buttons: Mit Gast Uwe Thimel geht es diesmal zurück in die Dotcom-Ära, als der "Webdesigner" noch alles in Personalunion machte, und zeichnen den Weg zu spezialisierten Rollen für UX, UI und Frontend nach. Warum Kunden UX oft fälschlich auf das sichtbare Interface reduzieren, weshalb eine frühe Investition in UX bares Geld spart und ob der Begriff "Digital Product Design" nicht treffender wäre – all das haben wir in dieser Folge besprochen.
Last, but not least
Die Kaffeekasse Die Anomalie und der Podcast sind kostenlos und entstehen in meiner Freizeit. Hauptsächlich, weil mir das viel Spaß macht. Ich habe aber eine kleine virtuelle Kaffeekasse auf der Plattform Ko-Fi und freue mich da über den ein oder anderen virtuellen Kaffee, den ich selbstverständlich zeitnah in ein koffeinhaltiges Heißgetränk umwandeln werde.
Twitch Einmal in der Woche bin ich live auf Twitch und rede da über die aktuellen Techniknews der Woche. In der Regel ist das der Mittwochabend.
Discord Im Discord gibt es immer mehr super nette Leute, die über spannende, witzige und teils auch ernste Themen diskutieren. Schau doch auch mal vorbei!
Themenvorschläge Welches Thema würde dich denn in einer der nächsten Ausgaben interessieren? Schreibs mir gerne als Antwort auf diese Email.
PS: Füge meinen Absender hallo@digitaleanomalien.de deinen Kontakten hinzu, damit der Newsletter auch zuverlässig bei dir ankommt und nicht im Spam landet.
